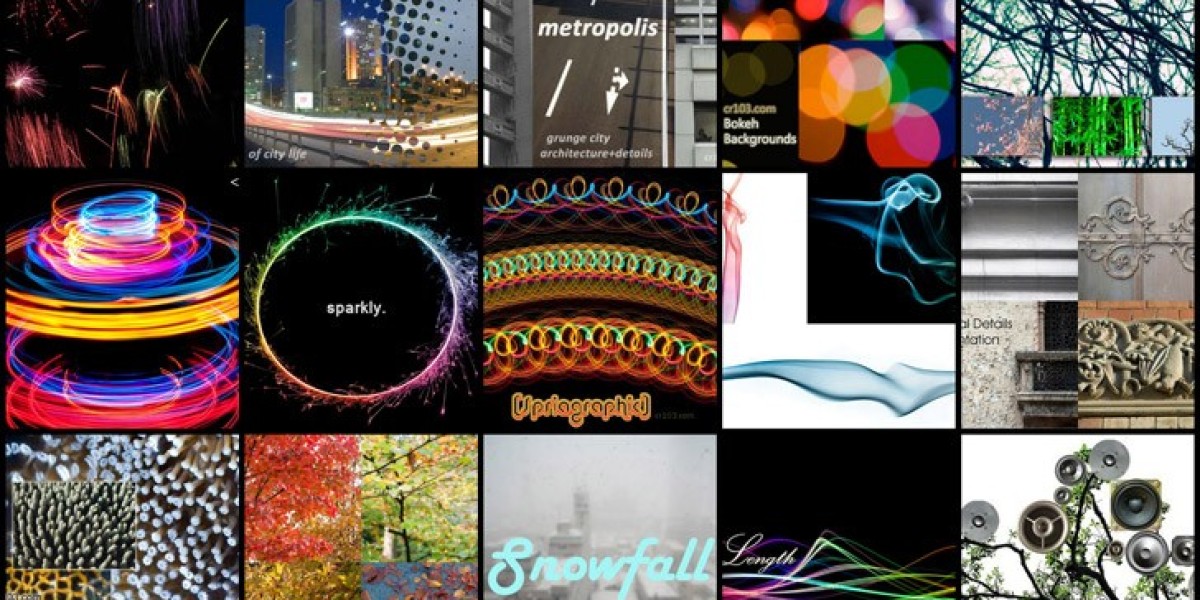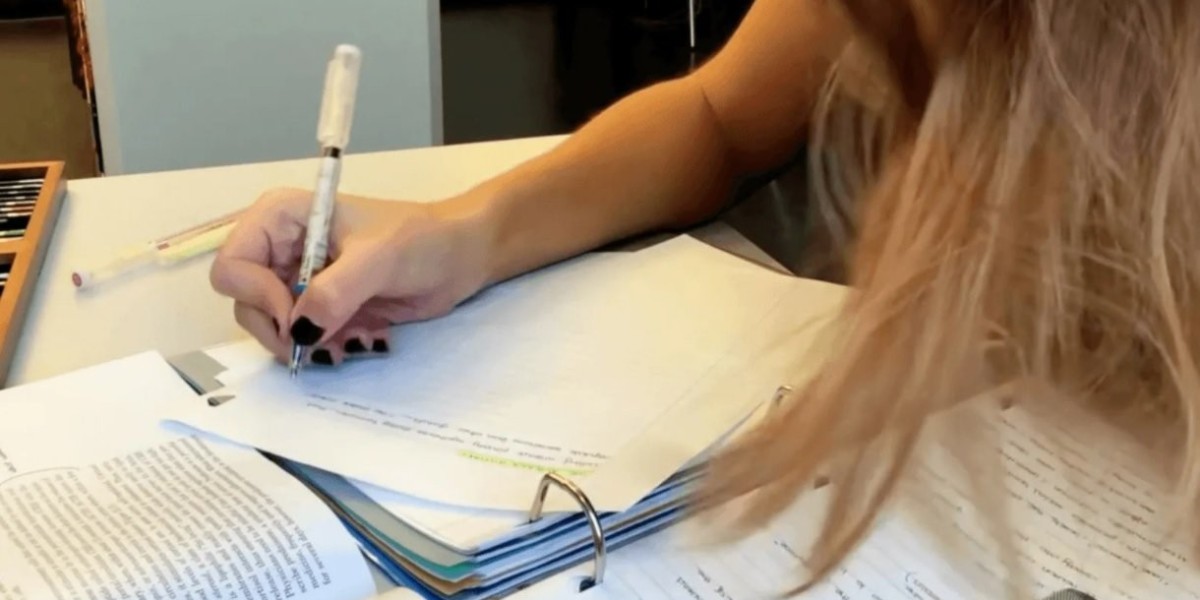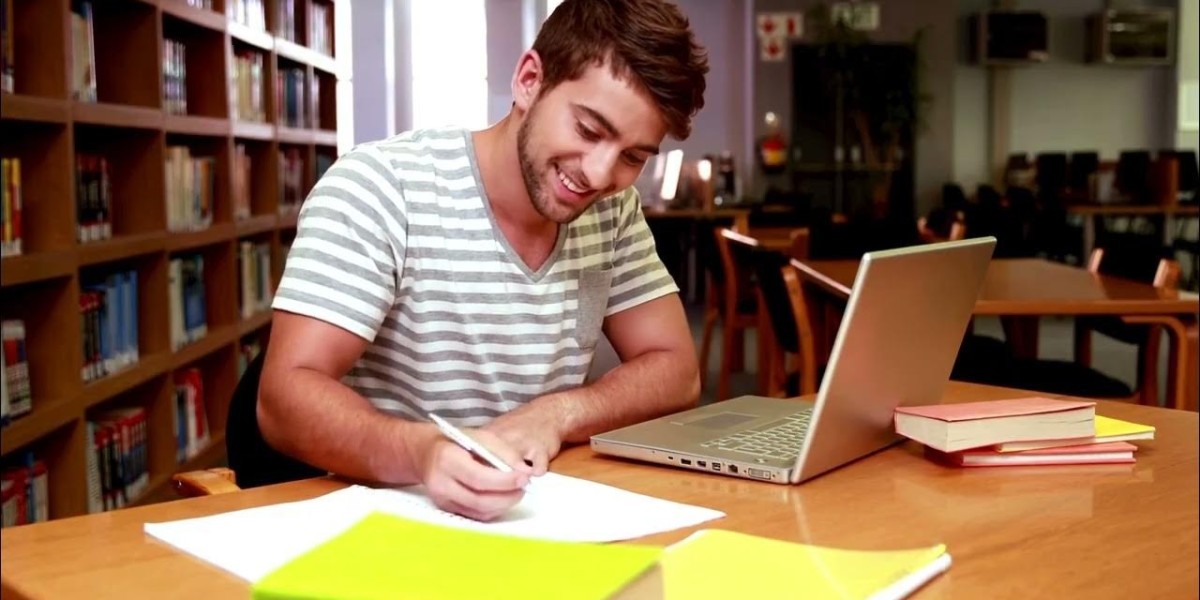---
- Was ist IGF-1?
- Warum werden IGF-1-Werte gemessen?
- Diagnose: Abnormale Werte können auf hormonelle Störungen wie Akromegalie oder GH-Defizienz hinweisen.
- Therapieüberwachung: Bei Patienten mit Wachstumshormontherapien hilft die Messung, die Behandlung zu optimieren.
- Forschung: IGF-1 wird in Studien zur Alterungsforschung und Krebsprävention untersucht.
- Normwerte – Wie sehen typische Referenzbereiche aus?
- Messmethode
- Interpretation der Ergebnisse
- Einflussfaktoren
- Alkohol: Kann IGF-1 senken.
- Körperliche Aktivität: Regelmäßiges Training erhöht den Wert moderat.
- Ernährung: Proteinreiche Diäten fördern die Produktion.
- Medikamente: Kortikosteroide, Antiepileptika und andere können den Wert beeinflussen.
- Was tun bei abnormalen Werten?
- Ärztliche Rücksprache: Besprechen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Arzt.
- Weitere Untersuchungen: Hormontests (GH, LH, FSH), Bildgebung (MRT der Hypophyse) oder Leberfunktionstests können angefordert werden.
- Behandlungsplan: https://www.argfx1.com/ Bei GH-Überproduktion kann eine Operation oder Strahlentherapie nötig sein; bei Defizienz kann eine Ersatztherapie sinnvoll sein.
- Häufig gestellte Fragen
- Fazit
- Typ: Peptidhormon, 70-Aminosäuren lang
- Hauptproduktionsort: Leber (nach Stimuli wie Wachstumshormon)
- Wirkmechanismus: Bindung an IGF-1-Rezeptor → Akt/PI3K-Signalweg, MAPK-Weg
- Physiologische Funktionen: Zellproliferation, Differenzierung, Antiapoptose, Knochen- und Muskelwachstum, metabolische Regulation
- Messung: Serumwerte durch ELISA oder RIA; Referenzbereiche variieren je nach Alter und Geschlecht
| Altersgruppe | Normalbereich (ng/ml) |
|---|---|
| Neugeborene | 500–2 000 |
| Kinder | 300–1 200 |
| Erwachsene | 100–300 |
| Ältere | 50–150 |
Hinweis: Die Werte variieren je nach Labor und verwendeter Analysemethode.
---
| Ergebnis | Mögliche Ursachen |
|---|---|
| Zu niedrig | GH-Defizienz, Unterernährung, Lebererkrankung, Schilddrüsenunterfunktion |
| Zu hoch | Akromegalie, GH-Überproduktion, Tumoren (z. B. Hypophysenadenom), Übergewicht |
Eine Abweichung von der Norm allein reicht jedoch nicht zur Diagnose; weitere Tests und klinische Befunde sind nötig.
---
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wie oft sollte ich IGF-1 testen? | Für Patienten mit bekannten Störungen: alle 6–12 Monate. Bei gesunden Erwachsenen ist ein jährlicher Check selten nötig. |
| Kann ich den Wert selbst beeinflussen? | Ja, durch Ernährung, Bewegung und Vermeidung von Alkohol können Sie ihn positiv beeinflussen. |
| Ist IGF-1 ein guter Alterungsmarker? | Studien zeigen Zusammenhänge, aber es gibt noch keine eindeutige Aussagekraft für klinische Praxis. |
---
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) ist ein zentrales Hormon im menschlichen Körper, das vor allem für die Regulation von Zellwachstum, Zellteilung und Differenzierung verantwortlich ist. Es wird hauptsächlich in der Leber als Reaktion auf Wachstumshormonsignale produziert und wirkt sowohl autark als auch parakarn, indem es an spezifische IGF-1-Rezeptoren bindet und eine Signalkaskade auslöst, die zur Proteinsynthese, zum Zellüberleben und zur Gewebeerneuerung führt. Darüber hinaus spielt IGF-1 eine entscheidende Rolle in der Knochenbildung, im Muskelaufbau sowie bei der Steuerung des Energiestoffwechsels.
IGF-1 – Auf einen Blick
Bei einem IGF-1-Mangel können Wachstumsverzögerungen auftreten, insbesondere bei Kindern, was zu einer vermöglichen „Wachstumshormonmangel"-Diagnose führen kann. In Erwachsenen äußert sich ein niedriger IGF-1-Spiegel häufig durch Müdigkeit, Muskelschwäche und eine abnehmende Knochenmineraldichte, was Osteoporose begünstigt.
Ein Überschuss an IGF-1 hingegen ist mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebsarten verbunden, da die verstärkte Zellproliferation unkontrolliert wachsen kann. Zudem wurde ein Zusammenhang zwischen hohem IGF-1 und metabolischen Störungen wie Typ-2-Diabetes sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. In seltenen Fällen führt ein zu hoher IGF-1-Spiegel zu acromegaly, einer Erkrankung mit übermäßigem Knochen- und Weichgewebswachstum.
Die Balance von IGF-1 ist daher entscheidend für die Aufrechterhaltung der normalen physiologischen Funktionen und die Prävention von Krankheiten. Untersuchungen zur Modulation dieses Hormons, sei es durch Ernährung, Bewegung oder medikamentöse Therapie, stehen im Fokus aktueller Forschung, um sowohl Wachstumsprobleme als auch Überwachungsrisiken gezielt zu adressieren.